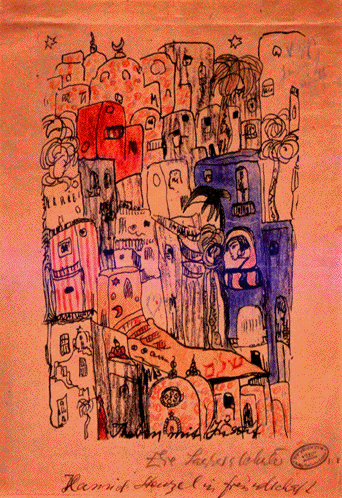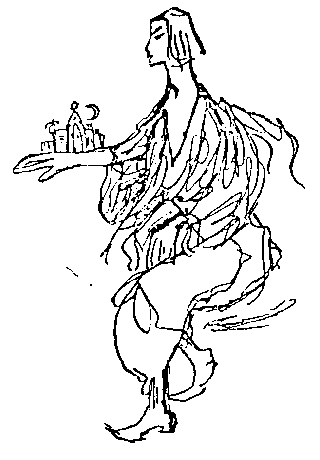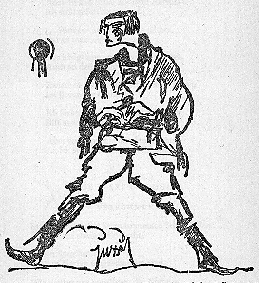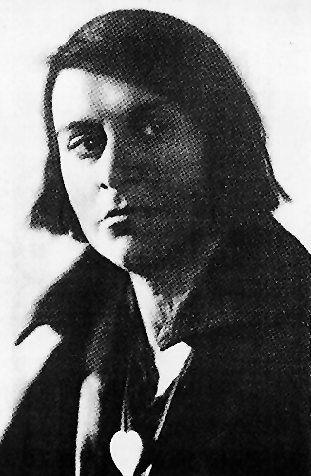| Ein Prototyp: Else Lasker-Schüler - Dichterin in der *Metropole *Berlin um 1900
Johannes Binotto
Ein Referat im Rahmen des Seminars »Kulturszene Wien-*Berlin 1900: Die Genese der *Moderne«, gehalten am 19.5.2000

Unwegsamste lyrische Erscheinung des modernen Deutschland (1) hat Karl Kraus sie genannt. Ein Gemeinplatz mittlerweile, der bestimmend für die *Rezeption Else Lasker-Schülers geworden ist. Dabei weist dieses Wort in eine falsche Richtung und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Hat doch das Wort "Unwegsam" Anklänge an eine Naturszene, etwa die eines Dschungels oder Gebirges. Else Lasker-Schüler wird so gleichsam unter der Hand Naturverbundenheit attestiert – ein Klischee, das bis heute in der Rezeption der Dichterin herumgeistert. *Andererseits wird mit dem Merkmal der "Unwegsamkeit" auf die scheinbare Sperrigkeit und Unzugänglichkeit (vielleicht gar Unzulänglichkeit) von Else Lasker-Schülers Werk verwiesen.
Angesichts dessen scheint es wenig fruchtbar, ausgerechnet diese unwegsamste Ausnahmedichterin als typischen, prototypischen Vertreter des Berliner *Grossstadtautors um 1900 und ihren Entwicklungsweg als programmatisch für den anderer zu präsentieren. Aber, wie ich zeigen möchte, vollzieht sich gerade an Else Lasker-Schüler in ausgeprägt radikaler, vor allem aber griffiger Weise, was als theoretische Bedingungen für den Künstler im urbanen Umfeld hervorzuheben ist. Else Lasker-Schüler soll also für einmal nicht herhalten als exotischer Ausnahmefall, sondern vielmehr herangezogen werden als praktisches Beispiel, als Vor-bild.
I Stadt – Geschichte – Biographie
Als Elisabeth Schüler 1894 den Arzt Berthold Lasker heiratet, zieht sie mit ihm vom ländlichen Elberfeld, ihrem Geburtsort in die Stadt Berlin, jener Stadt, der Mdme de Staël gerade aufgrund ihres rasanten Wachstums ein Fehlen von Geschichte attestierte:
|
|
Berlin (...) comme il n’y a pas long-temps qu’elle est rebâtie, on n’y voit rien qui retrace les temps antérieurs. (de Staël, 147)
|
Im Geschichtsvakuum der Stadt geht der Künstler auch seiner eigenen Biographie verlustig. Es wird ihm in der Geschichtslosigkeit nicht nur möglich und notwendig, seine Zukunft neu zu gestalten - auch die persönliche Vergangenheit kann hier rückwirkend einer Überarbeitung unterzogen werden, welche die momentane Situation als Künstler, insbesondere als Grossstadtkünstler erklärt und legitimiert: Else Lasker-Schüler, die im eigenen Atelier zu schreiben, malen und fotografieren beginnt, ändert alsbald ihr Geburtsjahr von 1869 in 1879. Sie verdreht, kaschiert, übertreibt und fabuliert die Herkunft und den Beruf der Eltern. Sie stilisiert sich selbst zum Wunderkind, das mit zwei Jahren bereits ein untrügliches Gehör für Reime hatte und drei Jahre später schon zur vollendeten Dichterin erwuchs:
|
|
Fünfjährig dichtete ich meine besten Gedichte (GW II, 518)
Ich habe seit Kindauf gemalt, habe mich dann mit einem Plebejerzigeuner verheiratet, der Tag und Nacht in verräucherten Cafés gespielt hat. (Brief an Richard Dehmel 9.11.1903; Briefe I, 10)
|
Solche Selbstmystifikation, deren gemässigtere Vertreter bis heute fleissig und unkritisch weiterkolportiert werden, ist jedoch weniger Produkt dichterischer Eitelkeit, als vielmehr Reflex von Else Lasker-Schülers Glaube in die wirklichkeitsverändernde Macht der Poesie.
Die Dichterin zieht im geschichtslosen Berlin gar eine noch weiterreichende Konsequenz: Nicht nur, dass sie die Daten ihrer Autobiographie verändert – sie erkennt das verinnerlichte *System der Zeit, das bis anhin Gültigkeit hatte, als in der *Metropole aufgehoben, als aufgegangen in Ewigkeit:
|
|
...mein Herz (...) es hat weniger Augenblickswert als Ewigkeitswert, darum bin ich vollständig unbrauchbar für den Vorbeipassierenden, ich bin nur interessant für den Forscher. (GW II, 187)
|
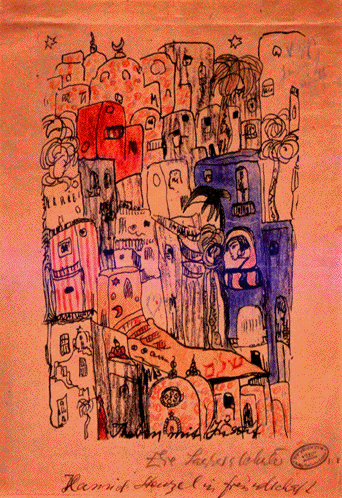
Die Dichterin, scheinbar konkret platziert in der Stadt, sieht sich gesitig ausgedehnt über alle Zeit und erstreckend über jeden Ort:
|
|
Ich bin in Theben (Ägypten) geboren, wenn ich auch in Elberfeld zur Welt kam im Rheinland. Ich ging bis 11 Jahre zur Schule, wurde Robinson, lebte fünf Jahre im Morgenlande, und seitdem vegetiere ich. (Pinthus, 294) (2)
Wie alt bin ich (...)? Tausend und vierzehn. (GW II, 387)
|
Else Lasker-Schüler bemerkt an sich vollzogen, was als typisches, insbesondere Berlinerisches Metropolenphänomen aufflammt, jene Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die der vorbeipassierende Berlin-Forscher Walter Benjamin erkennen und reflektieren wird:
|
|
Nicht so ist es, dass das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft, sondern Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt. (Benjamin, 577) (3)
|
Else Lasker-Schüler scheint eben dies, jenes Zusammentreten des sich Ausschliessenden zu erspüren – fernab jeder Theoriebildung verhält sie sich in der Schaffung und andauernden Revision einer Autobiographie voller Widersprüche und Unmöglichkeiten radikal diesem Phänomen entsprechend, im Gegensatz zu Benjamin allerdings gänzlich unreflektiert und ohne noch zu ahnen, wie signifikant ihr Verhalten für den modernen Dichter im allgemeinen ist.
II Stadt – Land
Definiert sich die moderne Grossstadt nicht zuletzt über den Kontrast zur ländlichen Gegend, so sieht sich der Künstler der Moderne, selbst nach einer anfänglichen Faszination, mehr und mehr abgestossen vom Moloch der Metropole und flüchtet, wie unter dem MottoðLos von BerlinÐ geschehen (4), zurück aufs Land, auch wenn so eine Ausflucht meist wenig mehr als ein Ausflug ist und allein dazu dient, mal kurz Kräfte, Inspiration und Material zu tanken.
Dem gegenüber stehen Künstler wie Ludwig Meidner, Georg Heym oder Alfred Lichtenstein, welche die Grossstadt als ihre ureigene Stoffquelle erkennen.
Betrachtet man nun die Werke Else Lasker-Schülers, insbesondere ihre Gedichte, so ist man zunächst wohl versucht, sie, wenn nicht gleich der Naturlyrik, so doch einer blühenden und reinen Natur, nicht aber der Stadt verhaftet anzusehen. Ihre ruhigen, oft meditativen Betrachtungen einer (anscheinend) paradiesischen Umgebung sind allzu verschieden von den sausenden Lichtkegeln, Menschenfetzen und dröhnenden Farbmassen (5) eines Ludwig Meidner, als dass sie auf demselben Nährboden gedeihen könnten. Da mag es überraschen, dass in Reaktion auf den Rückzug der Künstler aufs Land, es gerade auch Else Lasker-Schüler war, die ihre Kollegen zurück in die Stadt rief:
|
|
Donnerwetter, mutig ist es eben, mitten in der Stadt sich unter Verschiedenart der Menge zu begeben. Wir Künstler sind doch Erschaffende, in uns liegt das Material. Zieht sich Gott etwa auf ein Dorf zurück? Wie der ästhetisch Schaffende – seine Romanseele lüftet auf der Weide in Worpswede oder Lüneburger Heide. (...) Meine Liebe zu der Stadt Berlin, zu allen großen Städten, schließt natürlich meine Liebe zu den Wiesen und Wäldern keineswegs aus. Ich entzücke mich wie keine zweite über alles, was wächst auf der Erde (...) Aber zum Dichten und Zeichnen habe ich mich vor allen Dingen und von allen Dingen am nötigsten. (GW I, 638ff.)
(6)
|
Dass es Else Lasker-Schüler, selbst immer wieder gequält und abgestossen von den Bedingungen der Grossstadt, mit diesem Aufruf zur Rückkehr in die Metropole ernst war und wie sehr ihr diese als Ort der künstlerischen Tätigkeit gar unüberwindlich schien, das zeigen ihr eigenen Fluchtversuche aufs Land zum Maler und *Freund Franz Marc.
In der *Freundschaft mit Marc hatte die Dichterin den wahrscheinlich einfühlsamsten ihrer Gesprächspartner gefunden, der sich am verständigsten auf die Poesiewelt Else Lasker-Schüler einlassen konnte. Und doch besteht zwischen den beiden ein tiefes Missverständnis, das sich genau um die Opposition Stadt/Land dreht. Für Franz Marc ist die reale Natur die Quelle der Inspiration. Die Natur, der er mit seinem Werk nachspürt, ist für ihn in Sindelsdorf, wo er wohnt, konkret erlebbar. Er hat seinen Traumfelsen in der Realität gefunden, auf den er nun auch seine Freundin rufen möchte:
|
|
Liebster Jussuf. Komm‘ aus Deiner Grube zu uns auf den Traumfelsen [Sindelsdorf]. Dort kann man schweigen und sich lieben. (...) Berlin ist ein kranker Traumgrund. Komm‘ auf unsere Höhe. (Marc, 155)
|
Doch der Besuch auf dem Land wird für Else Lasker-Schüler unerträglich, wie Marcs Ehefrau Maria bezeugt:
|
|
...wir haben sie (ELS) mit uns (Maria Franck und Franz Marc) nach Sindelsdorf genommen, damit sie sich hier erholen sollte. Sie hielt aber die Einsamkeit und die Stille in der Natur nicht aus: Jahre hindurch hat sie nur in Berlin zwischen Mauern und in Kaffeehäusern gelebt, und so war diese plötzliche Veränderung keine Wohltat, sondern eine Beunruhigung für ihre kranken Nerven. (Franck, 146-149)
|
Else Lasker-Schüler muss zurück in die Stadt, zunächst ins nahe München und danach wieder zurück nach Berlin. Die Dichterin erweist sich als eindeutige Pflanze der Grossstadt, die nirgendwo sonst zur Ruhe kommt. Auch auf sie scheint sich zu beziehen, was Paul Westheim notiert:
|
|
Ich kenne einige Menschen in Berlin, für die, wenn sie müde, abgespannt, nervös sind, die Erfrischung ist, sich eine halbe Stunde am Potsdamer Platz oder an der Gedächtniskirche auf eine Caféterasse zu setzen und hineinzublicken in das Gewühl der großen Stadt, das vor ihnen brandet. (Westheim, 318)
|
Für Else Lasker-Schüler liegt, ebenso wie für ihren Freund Gottfried Benn, die Inspiration in den Strassen:
|
|
Wir sind aus Riesenstädten, in der City, nur in ihr schwärmen und klagen die *Musen. (Benn, 102)
|
Nur hier fühlt sie den Puls der Kreativität, nur hier hört sie, welche Stunde die Kunst geschlagen hat. Sie selbst schreibt:
|
|
Unsere Stadt Berlin ist stark und furchtbar, und ihre Flügel wissen, wohin sie wollen. Darum kehrt der Künstler – doch immer wieder zurück nach Berlin, hier ist die Uhr der Kunst, die nicht nach, noch vor geht. (GW I, 638)
|
III Tempo
...hier ist die Uhr... Auch wenn ihre kontemplativen Gedichte anderes vermuten lassen, hat Else Lasker-Schüler nur zu gut das rasende Schlagen der Stadt verspürt.
|
|
Dieses Berlin, kreisende Weltfabrik. Tempo: auf Rollen laufen die Einwohner, entnerven oder verstehen sich zu entorganisieren, vermögen maschinell zu werden. Immerhin, bitte, sympathischer als die Kleinstädter (Anwesende ausgenommen), die auf den Leibern kriechen. – Glühender bewillkommnet man hier den menschgebliebenen Menschen, der sich die Räder wieder von den Schuhen abschnallen kann; seine Prüfung, die die Großstadt ihm auferlegt. Besteht er sie, bleibt er lebendig. (GW I, 638f)
|
Sie nimmt sensibel die sinnliche Überreizung in der Grosstadt wahr, eine Sinnüberreizung, die, wenn auch weitgehend der städtischen Umgebung entkleidet, typisch wird für ihre Arbeit. Die scheinbar Verträumte ist wohl vertraut mit den neuen, fiebrigen, blitzhaften Wahrnehmungsweisen der Moderne, auch wenn sie sich über diese erhebt und in ihren schwebenden Gedichten zu einer neuen Ruhe zu finden versucht.
|
|
Der Schreibstil der bewegten *Bilder und der raschen Schnitte, mit dem die Lyriker schon bald Lichter und Schatten auf dem Asphalt tanzen ließen (...) mit Ausnahme der kindlich wissenden Else Lasker-Schüler, deren Augen auf Weltaltern ruhten und die eben darum den herausfordernden Zeittakt, mit dem Berlin seinen Schriftstellern die Fabrikation wechselnder Bilder abforderte, als eine Bewährungsprobe erkannte, über deren Bestehen jeder Tag neu entscheiden konnte. (Lämmert, 20)
|
Doch die Ruhe ist eine, die mühsamst errungen werden muss. Auch Else Lasker-Schüler kann kaum anders wahrnehmen, als mit dem fahrigen, nirgends ruhenden *kinomatographischen Auge. Der Overdrive der Moderne, die Stadt auf Rädern (ein Bild, das heute, angesichts der von Inlineskates, Skate- und Kickboards durchrasten Stadt fast prophetisch anmutet), das ist für sie, wenn auch enervierende und in die Hysterie treibende, doch die beste aller möglichen Welten. Eine Loslösung von der Stadt aber ist längst nicht mehr möglich.
|
|
Sie [die Großstädter] tragen die Stadt mit sich in die Berge und an das Meer. Sie haben das Land in sich verloren und finden es draußen nicht wieder. (Sprengler, 677)
|
Kein Traumfels mehr zu finden. Der Zeittakt (7) Berlins ist in den Puls Else Lasker-Schülers eingegangen.
IV Der neue Mensch
Während bereits die Grossstadt Berlin selbst durch ihr Geschichtsvakuum einen neuen Menschen mit neuer Biographie zu fordern scheint, tauchen solche Rufe bald als Moderne-Konzepte in Boheme- und Gruppenmanifesten auf. Die Brüder Hart liegen absolut im Trend, als sie den neuen Menschen der Moderne proklamieren:
|
|
Ewig Dieselben, ewig anders, nie geboren und unsterblich, - in ewigen Verwandlungen, stets neugestaltet, schreiten wir durch alle *Räume und Zeiten, durch ewig neue und andere Welten dahin, - zugleich unser Schöpfer und unser Geschöpf. (Hart, 57f)
|
Ihr unverdauter Theoriekuchen um diesen Neuen Menschen und die "Neue Gesellschaft" (8) scheint allerdings wenig mehr als hehre Worte zu sein, wenn man anhand der brieflichen Auseinandersetzung zwischen Julius Hart und Wilhelm Bölsche (9) erkennt, welch bornierte Vereinsmeierei hier betrieben wird. Auch Else Lasker-Schüler nimmt auf diesen Zwist Bezug, zunächst schlichtend, später in Distanznahme zu der Gruppe, die in ihren Augen zum kleinkarierten Kaffeekränzchen verkommen ist. Bald wendet sie sich endgültig und lakonisch ab.

Während über den Neuen Menschen bei den Harts nur theoretisiert wird, hat eines ihrer Mitglieder am Rande längst damit ernst gemacht: Else Lasker-Schüler, die ihre Person mit den widersprüchlichsten Mythen umgibt, wird unter Anleitung Peter Hilles, der sie bei den Harts einführte, ihr Schöpfer und Geschöpf, wie es die Gastgeber forderten. Doch geht sie über eine mittels veränderter Lebensdaten neugebildete Identität hinaus. Mit Hilfe des Mentors Hille prägt sich Else Lasker-Schüler eine neue Figuration des eigenen Ich auf: "Tino von Bagdad". Diese ist als Dichtervertreterin innerhalb ihrer Werke »Das Peter Hille-Buch« und »Die Nächte der Tino von Bagdad« entschieden mehr als nur eine Maske, nämlich die mehr und mehr sich selbst als Dichterin verwirklichende Autorin selbst. Die Grenze zwischen Else Lasker-Schüler und Tino beginnen zu verwischen, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass die Dichterin ihre Briefe, selbst die prosaischsten mit Tino zu unterzeichnen und als Kunstfigur im Alltag aufzutreten beginnt. Eine andauernde *Selbstinszenierung, ja Selbsterschaffung hebt an. So berichtet Gottfried Benn:
|
|
Man konnte weder damals noch später mit ihr über die Straße gehen, ohne daß alle Welt stillstand und ihr nachsah: extravagante weite Röcke oder Hosen, unmögliche Obergewänder, Hals und Arme behängt mit auffallendem, unechtem Schmuck. (Benn GWI, 537)
|

Doch wird Tino als ursprüngliche *Phantasie Peter Hilles für die Autorin, welche ihren Freund und Lehrer zu überflügeln beginnt, bald zu eng. Else Lasker-Schüler emanzipiert sich von ihrem Begleiter Hille und in dieser Krise muss auch die Tänzerin Tino mit den Zügen des Groupie einer neuen Gestalt weichen, jener berühmten IchfigurationðJussuf von ThebenÐ:
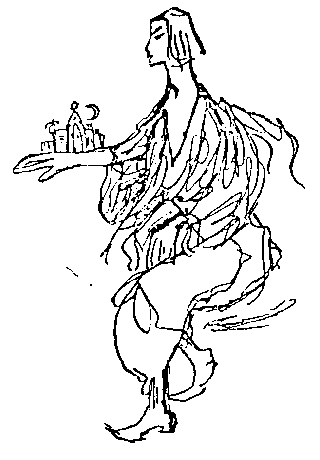
|
|
In der Nacht meiner tiefsten Not erhob ich mich zum Prinzen von Theben. (GW II, 534f)
|
Jussuf trägt als Verquickung von biblischem Joseph mit islamischem Scheich zwar weiterhin die Mission der Völkeraussöhnung, zu deren Zweck Peter Hille die Dichterin ursprünglich zu Tino ernannte. Der Prinz von Theben verfügt allerdings noch über weit mehr Handlungsspielraum als Tino und ist, entsprechend Else Lasker-Schülers Emanzipation, deren ureigenstes Geschöpf.
Die knabenhafte, zwischen Frau und Mann schillernde Gestalt wird zur *Spielfigur, zum überhöhten Ich, zum Schutzschild und Joker, den die Dichterin immer wieder ausspielt – als Sprachrohr in bestürzenden Liebesbriefen ebenso, wie in aggressiven Repliken auf die Anwürfe von Verlegern und Kritikern.
Erinnern wir uns an die Worte Julius Harts über den Künstler in ewigen Verwandlungen: Else Lasker-Schüler schöpft sich mit Jussuf tatsächlich gänzlich neu. Bis zu ihrem Tod unterschreibt sie die Mehrheit ihrer Briefe mit Jussuf Prinz von Theben. Sie erreicht so mit der Erschaffung Jussufs den Gipfel in der Konstruktion des eigenen Ich und reisst, indem Jussuf ebenso als Hauptfigur innerhalb der Texte, wie auch als Unterschrift in der privaten Korrespondenz erscheint, sämtliche Grenzen zwischen Poesie und realem Alltag nieder.
V Der* imaginäre *Raum
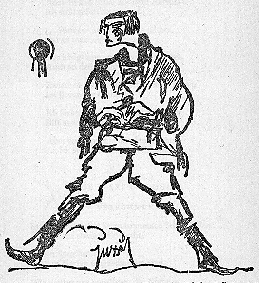
Der Prinz von Theben – das ist die Autorin, der Erzähler und Thema der Texte in einem. Diese Fokussierung in Jussuf, den Else Lasker-Schüler in ihrem Innern ist, zeigt auch, wohin sich der Blick der Autorin richtet: Nicht länger auf die Aussenwelt, sondern versenkend ins Selbst. Else Lasker-Schüler, der die Problematik, die Unzulänglichkeit, Enge und gleichzeitig eigenartige Gesichts- und Konturlosigkeit Berlins nur zu bewusst ist, flüchtet in ihr Inneres. Eine Flucht, die schon im Debut »Styx« vorausgesehen wird:
|
|
Weltflucht.
Ich will in das Grenzenlose
Zu mir zurück,
Schon blüht die Herbstzeitlose
Meiner Seele,
Vielleicht – ist’s schon zu spät zurück!
O, ich sterbe unter Euch!
Da Ihr mich erstickt mit Euch.
Fäden möchte ich um mich ziehn –
Wirrwarr endend!
Beirrend,
Euch verwirrend,
Um zu entfliehn
Meinwärts! (GW I; 14)
|
Sie erweist sich als eine lebensrettende Flucht und als Absage an alles, was ausserhalb der eigenen Kunst liegt:
|
|
Ich sterbe am Leben und atme im Bilde wieder auf. (GW II; 357)
|
Es ist dies der Rückzug in den* imaginären Raum im Innern in das eigentliche Refugium des modernen Dichters, dem angesichts der ihn erdrückenden und gleichzeitig in absolute Zusammenhangslosigkeit zersplitternde Metropole nur die Flucht auf den Herzensgrund bleibt. Draussen in den Strassen lautet das Fazit:
|
|
...hier wächst kein Paradies, kein Engel, kein Wunder. (GW II, 386)
|
Im Innern jedoch lässt sich die Stadt, die der moderne Mensch sowohl als bestimmend, als auch absolut unfasslich erfährt, neu und greifbarer aufbauen, wie es Rudolf Kayser beschwört:
|
|
In unserem Innern erbauten wir sie [die Großstadt] (...) Während an ihren nüchternen Alltagshäusern kein Blick sich entzündete, belebten wir sie phantastisch durch abseitige Gefühle. Darin offenbart sich ja die neue Kunst: daß sie die empirische Wirklichkeit der geistigen unterwirft, allen Lärm und Schein der Erde den Ideen unterstellt, die nur unserem Willen entstammen. (Kayser, 328)
|
Was dem modernen Dichter an Zusammenhängen in den Strassen verloren ging und auch die Ausflüge aufs Land nicht wiederzubringen vermochten, erwächst ihm in seinem Inneren neu – was Adorno über *Goethes »*Wanderers Nachtlied« sagte, könnte ebenso auf Else Lasker-Schüler und den Dichter der Moderne gemünzt sein:
|
|
Das Ich, das in Lyrik laut wird, ist eines, das sich als dem Kollektiv, der Objektivität entgegengesetztes bestimmt und ausdrückt; mit der Natur, auf die sein Ausdruck sich bezieht, ist es nicht unvermittelt eins. Es hat sie gleichsam verloren und trachtet, sie durch Beseelung, durch Versenkung ins Ich selber, wiederherzustellen. (Adorno, 53)
|
Else Lasker-Schüler, die paranoide Hysterikerin, die Nervenkünstlerin, die zeit ihres Lebens mit der sie umgebenden Stadt nicht zurecht-, aber auch nicht von ihr loskommt, baut eine neue Metropole in ihrem Herzen: die Stadt Theben – das inwändige Berlin sozusagen, dessen sie Prinz und das heisst Herr ist.
Während die Versenkung ins Ich Else Lasker-Schüler eine Wirklichkeit wieder verschafft, die sie draussen in Berlin nicht mehr finden und empfinden kann, vollzieht sich mit der Erhebung des eigenen Innern zum Gegenstand der Kunst, die aus ihrem Innern erst erwächst, die vollständige Auflösung zwischen Schauendem und Geschautem, zwischen Kunstwerk und Kunstwerker.
Früher als es zu erwarten wäre und ohne theoretische Erkenntnis, durchschlägt eine Dichterin im modernen Berlin die Scheidewand zwischen *Subjekt und Objekt. Sie ernennt sich selbst zum Gegenstand ihres Werks – und das Werk wiederum erhebt sie zur eigenen, neuen Identität. Paradigmatisch für die Nachfolgenden wählt die betrachtende Autorin sich selbst zum Betrachteten, blickt ausschliesslich sich selbst im Innern:
|
|
Und doch liegt in Wirklichkeit mein Theben in meinem Herzen unterm Bluthorizont und ich auf Thebens schimmernder Spielwiese. (Brief an Paul Goldscheider 3.7.1927. Briefe I, 172)
Und lausch vor meiner Herzensbühne im Parquet mein Höllenspiel. (»IchundIch«, 47)
|
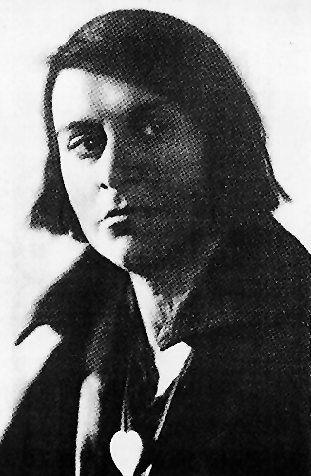
IIn Else Lasker-Schülers letztem, fragmentarischen Theaterstück »IchundIch« werden die erzählenden Figuren, fiktive, anderen Werken der Literatur entliehene, wie auch reale Persönlichkeiten und die Autorin selbst auf die Bühne zitiert, jene Herzensbühne die das Innere der Autorin selber ist. Das Kreisen in sich selbst, wozu der moderne Künstler der Grossstadt sich gezwungen sieht, wird zum Wirbel. Prototypisch und doch radikaler als kaum jemand davor und danach stürzt die Dichterin meinwärts und implodiert am Ende. Bühne und Spiel der Dichtung – Else Lasker-Schülers Herz – haben das nicht überlebt.
Anmerkungen:
1) Fussnote von Karl Kraus zum Abdruck des Gedichts Ein alter Tibetteppich. In: Die Fackel (Wien), XII. Jg., Nr. 313/314 (31. Dezember 1910), S. 36. (zurück)
2) Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dichtung. Hrsg. Kurt Pinthus. Berlin: Rowolth. 1920; S.294. (zurück)
3) Ich nehme hier Bezug auf das Referat vom 12.5.00: »Walter Benjamin: Berliner Kindheit um neunzehnhundert« von Carmen Bonomo, ebenfalls gehalten im Rahmen des Seminars »Kulturszene Wien & Berlin um 1900«. (zurück)
4) vgl. Fritz Lienhard: Los von Berlin? und Wilhelm Bölsche: Die Flucht vor der Stadt. In: Die Berliner Moderne 1885-1914. Hrsg. Jürgen Schutte , Peter Sprenngel. Stuttgart: Reclam. 1987; S. 220 ff. (zurück)
5) Ludwig Meidner: Anleitung zum Malen von Grossstadtbildern. In: »Kunst und Künstler« Nr.12 (1914) S.312-314. zit. n.: Gerda Breuer & Ines Wagemann: Ludwig Meidner. Zeichner, Maler, Literat. 1884-1966. Band 2. Stuttgart: 1991; S.291. (zurück)
6) Die kreisende Weltfabrik. Erstmals abgedruckt in: Vossische Zeitung, Nr. 180 vom 16. April 1922, Beilage. (zurück)
7) "Ihr, deren Dichterphantasie sich fremde Blumen, Paläste und Pharaonenwälder schuf, ist der harte Zeittakt, der die Gegenwart Berlins ausmachte, zu einem Lebenselement geworden..." (Eberhard Lämmert: Berlin...Uhr der Kunst, die nicht nach, noch vor geht. In: Berlin. Literary Images of a City. Hersg. Derek Glass, Dietmar Rösler, John J. White. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 1989. S.14). (zurück)
8) vgl. Heinrich & Julius Hart: Unsre Gesellschaft. In: Die Berliner Moderne 1885-1914. Hrsg. Jürgen Schutte , Peter Sprenngel. Stuttgart: Reclam. 1987; S. 634. (zurück)
9) vgl. Wilhelm Bölsche: Brief an Julius Hart. In: Die Berliner Moderne 1885-1914. Hrsg. Jürgen Schutte , Peter Sprenngel. Stuttgart: Reclam. 1987; S. 639). (zurück)
Quellen
- Gesammelte Werke in drei Bänden. Hrsg. Friedhelm Kemp. Frankfurt am Main: Suhrkamp.1996.
- Lieber gestreifter Tiger. Briefe von Else Lasker-Schüler. Hrsg. Margarete Kupper. Band I. München: Kösel. 1969.
- Wo ist unser buntes Theben. Briefe von Else Lasker-Schüler. Hrsg. Margarete Kupper. Band II. München: Kösel. 1970.
- IchundIch. Eine theatralische Tragödie. Hrsg. Margarete Kupper. München: 1980.
Literatur
- Theodor W. Adorno: Rede über Lyrik und Gesellschaft. In: Akzente. Zeitschrift für Dichtung. Hrsg. W. Höllerer & U. Bender, 4. Jg. 1975.
- Gottfried Benn: Doppelleben. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 1967.
- Gottfried Benn. Essays und Aufsätze. In: Gesammelte Werke in vier Bänden. Hrsg. Dieter Wellershoff. Bd. I. Wiesbaden 1959.
- Maria Franck an Elisabeth und August Macke, Sindelsdorf, 21.1.1913. In: August Macke – Franz Marc. Briefwechsel. Hrsg. Wolfgang Macke. Köln 1964.
- Julius Hart. In: Die Gesellschaft, Jg. 15 (1899)
- Rudolf Kayser: Literatur in Berlin. In: Das junge Deutschland 1 (1918), Nr. 2, S.41f. Hier zit. n. Sprengel / Streim: Berliner und Wiener Moderne. Wien-Köln-Weimar: Böhlau.1998.
- Eberhard Lämmert: Berlin...Uhr der Kunst, die nicht nach, noch vor geht. In: Berlin. Literary Images of a City. Hersg. Derek Glass, Dietmar Rösler, John J. White. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 1989.
- Franz Marc – Else Lasker-Schüler »Der Blaue Reiter präsentiert Eurer Hoheit sein Blaues Pferd«. Karten und Briefe. München 1987.
- Menschheitsdämmerung. Symphonie jüngster Dichtung. Hrsg. Kurt Pinthus. Berlin: Rowolth. 1920.
- Mme. La Baronne de Staël Holstein: De l’Allemagne. Tome I. Paris: H. Nicolle, Mame Frères. 1814.
- Oswald Sprengler: Der Untergang des Abendlandes. Bd.2. München 1980.
- Paul Westheim: Berlin, die Stadt der Künstler. In: Hier schreibt Berlin. Eine Anthologie von heute. Hrsg. Herbert Günther, Berlin 1929.
word doc
download word document
|
|